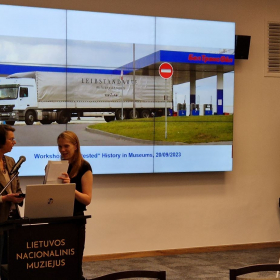Zwei Eichen
Was ich mir in Mogiljow vorgenommen hatte, hatte ich gesehen, mein Besichtigungsprogramm war abgeschlossen. Diese Rechnung hatte ich allerdings ohne Sergej gemacht, der mich als vermutlich solventen Fahrgast nicht so einfach von der Leine lassen wollte. „Jetzt sind wir schon mal unterwegs, außerdem müssen Sie jetzt, sozusagen als Ausgleich, auch einen Ort der sowjetischen Verteidigung gegen die Faschisten sehen“, schlug er mir, durchaus mit Berechtigung, wie ich fand, vor. Seine Empfehlung war das Bujinitscher-Feld, eine Gedenk- und Parkanlage am anderen Ende der Stadt. Ich hatte nichts dagegen, nach der bedrückenden Erinnerung an die „Euthanasie“-Morde auf andere Gedanken zu kommen. Und wie konnte das besser gelingen als durch einen Spaziergang an der frischen Luft im Grünen? Wir fuhren also einmal quer durch die Innenstadt und dann in Richtung Südwesten zum Dorf Bujinitschi. Hier hatte es heftige Kämpfe bei der Verteidigung der Stadt 1941 gegeben. Seit 1995 erinnert eine Park- und Gedenkanlage daran. Wie die meisten dieser Grünanlagen war auch diese eine seltsame Mischung aus Natur und Museum und wie aus dem Ei gepellt. Der Rasen akkurat auf Kante geschnitten, die Bäume in Reih und Glied und die Gehwege sauber gefegt. Keine herbstlichen herumfliegenden Blätter, keine wilden Blumen am Wegesrand und schon gar kein Unkraut. In regelmäßigen Abständen standen Bänke zum Verweilen, in einem Meter Abstand, immer rechts von einem Abfalleiner ergänzt. Wie in Trostenez, Chatyn, Kurapaty und unzähligen anderen Gedenkorten muss die Natur für die erhabenen Gefühle im Erinnern an eine historische Katastrophe bereitstehen. Zugleich darf sie aber keinerlei unkontrollierten Emotionen hervorrufen oder gar eine eigene Sprache entfalten. Nein, sie wird eingehegt und in ihrem Wachstum begrenzt, ihr Versuch, buchstäblich Gras über die Ereignisse wachsen zu lassen oder auch sich bauliche und militärische Überreste der Geschichte langsam wieder zu eigen zu machen, wird mit grimmigem Eifer vereitelt, und wenn es noch so mühsam ist. Davon zeugte ein Mann im hinteren Bereich einer großen Rasenfläche, der mit einem kleinen Rasenmäher unbeirrt hellgrüne Streifen in das ohnehin schon kurze, dunkelgrüne Gras, zog. Ihm folgte in einem größeren Abstand eine Frau in einem Arbeitsoverall und einem Kopftuch und säuberte die gemähte Fläche nochmal mit einem Reisigbesen.
 Langsam ging ich einen von drei Wegen auf einen roten Backsteinturm zu, hinter mir die große und befahrene Straße, im Blickfeld vor mir und an den Seiten einzelne Haine und größere Waldstücke sowie ein kleiner See. Mein Weg begann an einem Findling, auf dem vorne die Lebensdaten des sowjetischen Schriftstellers Konstantin Simonow (1915-1979) und hinten folgendes zu lesen war. „Sein ganzes Leben lang erinnerte er sich an das Schlachtfeld 1941 und ließ seine Asche hier zerstreuen.“ Ich wusste, dass der junge Simonow als Berichterstatter am Krieg beteiligt gewesen war. Nun erfuhr ich, dass er als einer der ersten Fotografen Bildmaterial aus dem Krieg nach Moskau geliefert hatte, und zwar aus Mogiljow. Es war einer seiner ersten Einsätze, die den 25jährigen tief beeindruckt haben müssen. Er verarbeitete seine Erfahrungen unter anderem in der Roman-Trilogie Die Lebenden und die Toten. Einer der Hauptfiguren ist der General Fjodor Fjodorowitsch Serpilin, in dem sich Züge des historischen Oberst des 388. Schützenregiments der 172. Schützendivision der 61. Schützenarmee, Semjon Fedorowitsch Kutepow, wiederfinden.
Langsam ging ich einen von drei Wegen auf einen roten Backsteinturm zu, hinter mir die große und befahrene Straße, im Blickfeld vor mir und an den Seiten einzelne Haine und größere Waldstücke sowie ein kleiner See. Mein Weg begann an einem Findling, auf dem vorne die Lebensdaten des sowjetischen Schriftstellers Konstantin Simonow (1915-1979) und hinten folgendes zu lesen war. „Sein ganzes Leben lang erinnerte er sich an das Schlachtfeld 1941 und ließ seine Asche hier zerstreuen.“ Ich wusste, dass der junge Simonow als Berichterstatter am Krieg beteiligt gewesen war. Nun erfuhr ich, dass er als einer der ersten Fotografen Bildmaterial aus dem Krieg nach Moskau geliefert hatte, und zwar aus Mogiljow. Es war einer seiner ersten Einsätze, die den 25jährigen tief beeindruckt haben müssen. Er verarbeitete seine Erfahrungen unter anderem in der Roman-Trilogie Die Lebenden und die Toten. Einer der Hauptfiguren ist der General Fjodor Fjodorowitsch Serpilin, in dem sich Züge des historischen Oberst des 388. Schützenregiments der 172. Schützendivision der 61. Schützenarmee, Semjon Fedorowitsch Kutepow, wiederfinden.
Als Simonow 1979 starb, sollte der berühmte Schriftsteller auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau begraben werden. Sein letzter Wunsch aber war es gewesen, seine letzte Ruhe auf dem Bujinitscher-Feld zu finden. Um dem nachzukommen, nutzten seine Witwe und die Kinder die Zeit der bürokratischen Vorbereitung der Beerdigung in der Hauptstadt, verließen die Stadt unbemerkt und machten sich mit der Urne auf den Weg nach Weißrussland. Sie waren vorher nie an dem Ort gewesen, den ihr Mann und Vater im Roman so beschrieben hatte: „Ich war kein Soldat, nur ein Reporter, aber ich habe ein Stück Land, das ich nicht vergessen kann. Ein Feld bei Mogiljow, das ich zum ersten Mal im Juli 1941 gesehen habe, als die Unsrigen innerhalb eines Tages 39 deutsche Panzer geschlagen und verbrannt haben… “ Also baten sie das örtliche Heimatmuseum um Hilfe, ohne zu sagen, weshalb sie gekommen waren. Als man ihnen die Stelle zeigte, verstreuten sie die Asche. Bei der Zeremonie waren nur sieben Menschen anwesend, darunter neben der Familie einige Veteranen der Schlacht. Die Moskauer Behörden hüllten sich in empörtes Schweigen. Erst ein Jahr später berichteten die Zeitungen über diese ungewöhnliche Beerdigung.
Von hier aus ging ich die so benannte Allee der Erinnerung und des Ruhms entlang. Das Schild informierte mich, dass sie zum 70. Jahrestag des Kriegsendes von Veteranen angelegt worden war. Und zwar im Rahmen eines Subbotniks, also eines Samstages, an dem die örtliche Bevölkerung von den Behörden zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen wird. Mich hat das berührt, denn was nach einer milden Form der Zwangsarbeit klingt, und von den meisten sicher auch so empfunden wird, war für die Veteranen vielleicht die Möglichkeit, sich gemeinsam und vermutlich mit Jugendlichen, die ihnen geholfen haben, an ihre Erfahrungen auf diesem ehemaligen Schlachtfeld zu erinnern. Und mit den Buchen, die sie rechts und links des Asphaltweges einsetzten, etwas Bleibendes und etwas Lebendiges hinterlassen.
 Ein wenig zurückgesetzt standen zwei einzelne Stileichen, ebenfalls 2015 zu Ehren der Soldaten der 2. Belorussischen Front gepflanzt, die Mogiljow im Juni 1944 befreit hatten. Das erfuhr ich, als ich, von den beiden Gartenarbeitern und den wenigen flanierenden Besuchern argwöhnisch beäugt, auf die Wiese trat, um die auf einem Stein angebrachte Tafel vor den noch schmächtigen Bäumchen lesen zu können. Warum es ausgerechnet Eichen sein mussten, fragte ich mich. Zwar stehen sie wie kein anderer Baum für den Frieden und die Ewigkeit, wie hier wohl den Sieg über die deutschen Feinde. Aber die Eiche ist auch eng mit einer als deutsch empfundenen Kultur verbunden. Schon seit dem 18. Jahrhundert wird sie als typisch deutscher Nationalbaum besungen, sie zierte deutsche Währungen von der Goldmark über die Reichsmark, die Mark der DDR und der Bundesrepublik. Und sie findet sich im Parteiabzeichen der NSDAP. Warum zwei Bäume, und warum an diesem Ort, mitten auf der großen Wiese, ohne Bezug zu den anderen Elementen der Gedenkanlage? Welchen Sinn hatten sie in dem Gesamtkonzept, das auf Überwältigung in Anbetracht der hier geschehenen Grausamkeiten und des großen Siegs zielte? Alle anderen Symbole wie die Allee, der Turm auf einer Anhöhe und das Kriegsgerät in Sichtweite dienten diesem Zweck, allein die beiden kleinen Eichen wirkten fehl am Platz. Vor meinen Augen sah ich sie als große, starke Bäume, die abseits der heroischen Anlage im Sommer Schatten spenden und im Winter Eis und Schnee trotzen würden. Das würde passen. Jetzt aber, als Jungbäume, erinnerten sie inmitten dieses konstruierten Narrativs widerspenstig daran, dass nicht der Mensch und nicht die Architektur, sondern nur die Zeit die Wunden heilen kann. Die Zeit, die es eben braucht, bis eine kleine Eiche groß und mächtig wird. Diese Form des Widerstandes gegen das um sie herum kontrollierte Gedenken gefiel mir. Ob dies allerdings auch die Idee derjenigen gewesen waren, die die Bäume gepflanzt hatten, ist eher unwahrscheinlich. Sollten die beiden Stileichen aber die nächsten Jahre überstehen, dann hätten sie uns alle überlistet.
Ein wenig zurückgesetzt standen zwei einzelne Stileichen, ebenfalls 2015 zu Ehren der Soldaten der 2. Belorussischen Front gepflanzt, die Mogiljow im Juni 1944 befreit hatten. Das erfuhr ich, als ich, von den beiden Gartenarbeitern und den wenigen flanierenden Besuchern argwöhnisch beäugt, auf die Wiese trat, um die auf einem Stein angebrachte Tafel vor den noch schmächtigen Bäumchen lesen zu können. Warum es ausgerechnet Eichen sein mussten, fragte ich mich. Zwar stehen sie wie kein anderer Baum für den Frieden und die Ewigkeit, wie hier wohl den Sieg über die deutschen Feinde. Aber die Eiche ist auch eng mit einer als deutsch empfundenen Kultur verbunden. Schon seit dem 18. Jahrhundert wird sie als typisch deutscher Nationalbaum besungen, sie zierte deutsche Währungen von der Goldmark über die Reichsmark, die Mark der DDR und der Bundesrepublik. Und sie findet sich im Parteiabzeichen der NSDAP. Warum zwei Bäume, und warum an diesem Ort, mitten auf der großen Wiese, ohne Bezug zu den anderen Elementen der Gedenkanlage? Welchen Sinn hatten sie in dem Gesamtkonzept, das auf Überwältigung in Anbetracht der hier geschehenen Grausamkeiten und des großen Siegs zielte? Alle anderen Symbole wie die Allee, der Turm auf einer Anhöhe und das Kriegsgerät in Sichtweite dienten diesem Zweck, allein die beiden kleinen Eichen wirkten fehl am Platz. Vor meinen Augen sah ich sie als große, starke Bäume, die abseits der heroischen Anlage im Sommer Schatten spenden und im Winter Eis und Schnee trotzen würden. Das würde passen. Jetzt aber, als Jungbäume, erinnerten sie inmitten dieses konstruierten Narrativs widerspenstig daran, dass nicht der Mensch und nicht die Architektur, sondern nur die Zeit die Wunden heilen kann. Die Zeit, die es eben braucht, bis eine kleine Eiche groß und mächtig wird. Diese Form des Widerstandes gegen das um sie herum kontrollierte Gedenken gefiel mir. Ob dies allerdings auch die Idee derjenigen gewesen waren, die die Bäume gepflanzt hatten, ist eher unwahrscheinlich. Sollten die beiden Stileichen aber die nächsten Jahre überstehen, dann hätten sie uns alle überlistet.
Ich ging weiter in Richtung Turm, das war das Wort, das Sergei benutzt hatte. Mir kam das seltsam vor, was für ein Turm? Ich ging vorbei an Panzern, Haubitzen und Kanonenwagen. Die sauber geputzten und neu in Tarnfarben gestrichenen Waffen gehören zu jedem Gedenkpark in diesen Breitengraden. Sie sind echt, aber degradiert zu bloßer Dekoration. Ein Schrecken oder gar die Vorstellung von Krieg gehen von ihnen nicht mehr aus. Vielmehr sind sie ein willkommener Abenteuerspielplatz für Kinder und eine kontrastreiche Kulisse für junge Frauen, die sich von ihren Freundinnen davor fotografieren lassen. So war es auch an diesem Vormittag. Die Schilder mit den Angaben zur Größe der Kaliber oder der Länge der Achsen nahm niemand zu Kenntnis. Ob das anders wäre, wenn man dort die Geschichte von einem jungen Soldaten lesen könnte, der in so einem Panzer genau hier gekämpft und überlebt und vor ein paar Jahren einen Baum für die Allee der Erinnerung gepflanzt hat? Oder aber in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet und dort wie drei Millionen andere ums Leben kam? Solche Geschichten werden leider noch immer viel zu wenig in weißrussischen Museen und Gedenkorten erzählt. Es geht immer „nur“ um Helden und wie viele deutsche Panzer sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens zerstört haben. Wie es den Helden nach dem Krieg erging, danach fragt keiner.
Nachdem ich die verschiedenen Informationstafeln an dem Turm gelesen hatte, verstand ich auch, dass es sich eigentlich um eine Art Kapelle handelte. Im Inneren waren die Namen der Kämpfer, die bei der Verteidigung von Mogiljow gefallen waren, verewigt. Unter dem Gebäude befand sich eine Krypta mit den Überresten der unbekannten Soldaten, die auf diesem Schlachtfeld gefunden worden waren. Der Turm war auf eine Anhöhe gebaut, die man über Stufen erreichen konnte. Von dort konnte ich nun auch den kleinen See vollständig sehen. Es war der See der Tränen und ist den Müttern gefallener Söhne und Männer gewidmet. In der stillen Wasseroberfläche spiegelten sich die vorbeiziehenden Wolken. Der leichte Wind trieb ihre grauen Schatten langsam von einem flachen Ufer zum anderen, dazwischen leuchteten die Wolkenlücken als helle, glitzernde Flecken. Die Ruhe und der Friede, die von diesem Bild ausgingen, aber auch der ständige Wandel der Spiegelung und die kaum wahrnehmbare Bewegung der obersten Wasserschicht ergriffen mich viel stärker als die ganze Akkuratesse der Anlage. Ich blieb lange stehen, vergaß, dass Sergei auf mich wartete. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, im Schmerz über diesen wahnsinnigen Krieg und seine Opfer mit den Frauen dieses Landstrichs verbunden zu sein.
Ich verließ die Anlage in die andere Richtung durch einen großen Torbogen, der die Nachgeborenen mahnen soll, wie es bei mir der See schon getan hatte. Zurück am Auto erzählte mir Sergei, dass er hier am Turm und vor dem Kriegsgerät, wie alle seine Freunde und die halbe Stadt, seine Hochzeitsfotos gemacht habe. So ist es Brauch hier, das war schon zu Sowjetzeiten so. Die Tradition, sich an historischen Orten, die an die Heldentaten des Vaterlandes erinnern, ablichten zu lassen, wird von sehr vielen Paaren fortgesetzt. Es ist eine ehrliche Erinnerung an die Toten. Es gibt praktisch keine Familie, die nicht jemanden im Großen Vaterländischen Krieg verloren hat. Und apropos. „Hochzeitsfotos haben wir noch an einem anderen Ort gemacht, da fahren wir jetzt auch noch schnell hin“, lachte Sergei. Mir war klar, dass ich sowieso keine Wahl hatte, und es machte mir Spaß, mich von ihm überraschen zu lassen und neue Orte zu entdecken.
Also fuhren wir weiter nach Süden auf der Ausfallstraße bis kurz vor das Ortschild Tschernosomowka. Die Straße säumten viele kleine Holzhäuser mit bunten Zäunen und zum Teil aufwendig verzierten Fensterrahmen. Hier zeigte sich das Dorf Bujinitschi von seiner schönsten Seite. Die Gärten blühten üppig und in vielen Farben, Obstbäume trugen rote Äpfel und reife Birnen. Wo ich einen Blick über den Zaun oder hindurch erhaschen konnte, sah ich ordentlich angelegte Kartoffel- und Gemüsebeete. Fast überall stand eine kleine Zementmischmaschine. Baumaterialien und Gerät aller Art zeugten davon, dass hier beständig am Eigenheim gebastelt und gewerkelt wurde. Auf dem etwa zwei Meter breiten sandigen Streifen zwischen den Grundstücken und der Straße saßen die Babuschkas in ihren bunten Schürzenkleidern und Kopftüchern auf Bänken in der Sonne. Ich träumte mich in diese Schrebergartenidylle, wohl wissend, dass davon keine Rede sein kann. Für die Menschen geht es darum, möglichst sparsam von der kargen Rente zu leben und sich durch den Verkauf von eigenem Obst und Gemüse etwas dazu zu verdienen. Die Jungen wohnen sowieso schon lange in der Stadt und unterstützen die Eltern und Großeltern auf dem Dorf, so gut es eben geht.
Sergei riss mich aus meinen Gedanken und wies nach vorne auf die rechte Straßenseite, wo ein ähnlicher Turm stand wie auf dem Bujinitscher-Feld. Hier war er kleiner und hell getüncht mit weißen Säulen, und wirkte auf einer kleinen Erhebung unmittelbar an der befahrenen Straße einsam und etwas lieblos. Eine provisorische Holztreppe führte hinauf. Der Vaterländische Krieg gegen Napoleon ist eben nicht der Große Vaterländische Krieg gegen Hitler, so einfach ist das manchmal mit der Gedenkkultur. Dieses Mal begleitete mich Sergei zu der Tafel, die an den Durchmarsch der französischen Armee und die am Kampf beteiligten Truppenteile auf russischer Seite erinnerte. “Genau hier haben wir Hochzeitsfotos gemacht“, verkündete er und stellte sich vor den Eingang in die Kapelle. „Weil man erinnern muss, und weil die Aussicht so schön ist“, er zeigte mit ausgestrecktem Arm in die Richtung, aus der wir gekommen waren. In einer Senke lag ein dunkler See. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass wir ihn überquert hatten. Er erstreckte sich rechts und links von der Straße und war umgeben von einem dichten Nadelwald. An einem Ufer stand ein großes Gebäude, das in seiner Dimension und Leere deplatziert wirkte. Das Hotel Grünes Städtchen, wie mir Sergej erklärte. An einem Steg schaukelten kleine Ausflugsboote. Auf der anderen Seite der Brücke am Ufer standen in gleichmäßigen Abständen ordentliche Grillplätze mit Abfalleimern für das zu allen Jahreszeiten beliebte Schaschlik. An dieser Stelle befindet sich die Quelle des Flüsschens Fatowka, der von dort nach Südosten fließt und unweit von Mogiljow in den Dnjepr mündet. Vermutlich hat man den kleinen See gestaut, um drumherum dieses Naherholungsgebiet anzulegen. Jetzt, im Herbst und unter grauem Himmel, war niemand zu sehen, alles wirkte verlassen. Wie bei den beiden Eichen spürte ich ein körperliches Unbehagen angesichts der Diskrepanz zwischen der Natur, die man hier einfing und für die Erholung geplagter Städter nutzte, und der ihr übergestülpten Einhegung durch Ordnung und Sauberkeit. Mich irritierte dieses Missverständnis, und ich fühlte mit der Natur, die stumm gegen ihre Verkennung zu protestieren schien. Der See lag still, kein Vogel war zu sehen oder zu hören. Eine unnatürliche Stille. „Herrlich, oder?“, strahlte Sergei. „Hier kann man super feiern!“ und er bestand drauf, zur Erinnerung ein Foto von mir vor dem See mit dem Hotel im Hintergrund zu machen.
Fotos: K. Janeke